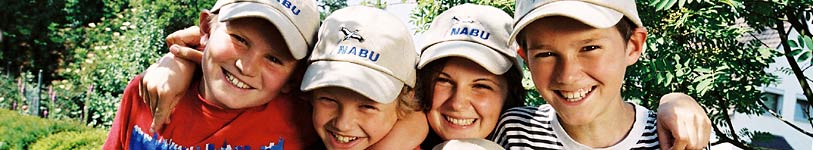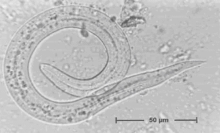Igel im Januar
Hunds-
oder Schweinsigel?
Bis
heute glauben manche Gärtner, Landwirte oder Jäger
daran, dass unser einheimischer Igel mit zwei Arten vertreten ist:
1.
als
„Hundsigel“ mit stumpfer Schnauze und steiler Stirn
und
2.
als
„Schweinsigel“ (oder Swinegel) mit spitzer Schnauze
und flacher Stirn
In
älterer Literatur kann man sogar noch weitere
Unterscheidungsmerkmale
finden. So sollen „Sauigel“
größer sein als ihre Kameraden der Art
„Hundsigel“
und auch deutlich wilder und aggressiver. Angeblich sollen sie sich
auch in den
„Wildnüssen und Höltzern“
aufhalten, während hingegen die „Hundsigel bey den
Häusern“ leben.
Trotz
dieser unterschiedlichen, wenn auch zum Teil
richtigen Beobachtungen (es gibt große und kleine Igel und
natürlich auch
unterschiedliche Lebensräume), handelt es sich allen
Fällen nur um eine einzige
Igelart – unser Europäischer Braunbrustigel
(Erinaceus europaeus).
Die
Erklärung für die fälschliche Annahme der
unterschiedlichen Arten ist simpel: ein erschreckter Igel zieht den
Kopf ein und
stellt die Stirnstacheln auf. Somit wirkt der Kopf runder und
kürzer. Wähnt
sich der Igel wieder in Sicherheit, so streckt er den Kopf wieder
langsam
heraus und legt seine Stacheln flach an.
So
verwandelt sich der „Hundsigel“ innerhalb
kürzester
Zeit in einen „Schweinsigel“!
Igel im Februar
Wie jedes Wildtier
beherbergt auch ein Igel eine
Vielzahl an Parasiten. Solche „Schmarotzer“ schaden
dem Tier nicht allzu sehr,
solange sich ihre Anzahl in Grenzen hält und der Igel gesund
und kräftig ist.
Zu
den äußeren Parasiten gehören unter anderem
Flöhe,
Zecken, Milben und Schmeißfliegen.
Der
Igelfloh (Archaeopsylla erinacei) lebt
ausschließlich auf dem Igel. Es kann auch mal vorkommen, dass
diese Flohart
einen Hund, eine Katze oder einen Menschen anspringt und
beißt. Dieser Wirt wird
aber wieder schnellstmöglich verlassen, sobald der Floh ihn
als „falsch“
erkennt. Bis zu 100 Flöhen können auf einem
erwachsenen Igel leben und von
seinem Blut trinken. Ist er gesund, stört ihn das nicht
weiter. Bei kranken
Tieren kann ein „Massenbefall“ jedoch zu einem zu
hohen Blutverlust und dadurch
zu Anämie führen.
Zecken
haben eine Vorliebe für den langsam durchs
Gebüsch streifenden Igel. Gerne setzen sie sich hinter Ohren,
am Bauch und am
Schwanzansatz fest und saugen sein Blut. Auch hier trifft das Selbe wie
beim
Igelfloh zu: ist der Igel gesund, so können ihm eine
überschaubare Menge an
Zecken nichts anhaben.
Die
verschiedensten Milbenarten suchen unseren Igel
heim. Am häufigsten kommt die Igelkrätzmilbe vor
– sie kann gut mit bloßem Auge
erkannt werden und jeder zehnte Igel ist von ihr befallen. Milben
graben
tunnelartige Fraßgänge durch die obersten
Hautschichten, Haare und Stacheln
fallen aus. Infizieren sich die feinen Hautwunden, so stirbt der Igel
oft
daran. Breiten sich Milben in den Ohren
bzw. den Gehörgängen aus, so kann der Igel seinen
Hör-, Gleichgewichts- und
Orientierungssinn verlieren.
Schmeißfliegen
machen sich bevorzugt über geschwächte
und verletzte Tiere her. Sie legen ihre Eier an Wundrändern
und feuchten
Körperstellen (Augen, Nase, Mund, After) ab. Die daraus
schlüpfenden Maden
können den Igel im wörtlichen Sinne bei lebendigem
Leib auffressen.
Hat man ein geschwächtes Tier zur Pflege, so ist die erste Aufgabe immer die Entfernung der äußeren Parasiten. Für Floh und Milben gibt es gute Präparate beim Tierarzt. Bei Zecken und Fliegeneier bzw. Maden hilft nur eines: die gute, alte Handarbeit!
Igel im März
Wie jedes Wildtier
beherbergt auch ein Igel eine Vielzahl
an Parasiten. Solche „Schmarotzer“ schaden dem Tier
nicht allzu sehr, solange
sich ihre Anzahl in Grenzen hält und der Igel gesund und
kräftig ist.
Zu
den inneren Parasiten gehören unter anderem
Fadenwürmer,
Bandwürmer, Coccidien und diverse Bakterien.
Fadenwürmer
findet man sowohl in den Lungen,
Speiseröhren und / oder dem Magen-Darm-Trakt der Igel. Nahezu
jeder Igel trägt
sie in sich, mittlerweile geht man davon aus, dass
Igelsäuglinge schon im
Mutterleib damit infiziert werden und erkrankt auf die Welt kommen. Als
besonders häufig und gefährlich haben sich der
Lungenwurm und der
Lungenhaarwurm herausgestellt. Verschiedene Krankheitsbilder - von
rasselnden
Atemgeräuschen, über trockenen Husten bis hin zu
Bronchitis oder
Lungenentzündung - können sie beim Igel
hervorrufen. Unbehandelt führen sie bei zu stark
geschwächten Tieren zum Tod.
Der
Igelbandwurm ist hauptsächlich für chronischen
(zumeist blutigen) Durchfall verantwortlich. Der Igel magert in relativ
kurzem
Zeitraum sehr stark ab und bei einem sehr hohen Befall stirbt das Tier.
Coccidien
sind Einzeller, die sich im Darm ansiedeln.
Treten Coccidien in großen Mengen auf, so führt das
zu blutigem Durchfall. Auch
Lähmungserscheinungen werden immer wieder beobachtet.
Coccidien können ebenso
zum Tode des Igels führen.
Am
Häufigsten kommen folgende Bakterien beim Igel vor:
Salmonellen
► rufen Durchfall und Appetitlosigkeit
hervor und führen schließlich zu Apathie
Leptospirose-Bakterien
► wird meist von Ratten
übertragen und verursacht eine Art Gelbsucht
Niemals dürfen diese Krankheiten „auf eigene Faust“ behandelt werden! Ein erkranktes Tier muss immer bei einem guten Tierarzt vorgestellt werden!
Igel im April
Der
lange Winter ist vorbei, der Frühling hat
begonnen, das erste Grün beginnt zu sprießen, die
ersten Schnecken und Würmer
kreuzen die Wege.
Steigen
die Temperaturen im Frühjahr nun langsam aber stetig
an, so erwachen auch unsere Igel allmählich aus ihrem
Winterschlaf. Dieser
Vorgang dauert mehrere Stunden, bis er vollständig
abgeschlossen ist. Die
Körperfunktionen werden ganz langsam wieder aktiviert.
Die
Stoffwechselprozesse, die hierbei ablaufen, liegen
weit über dem Normalen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass
auch die
Körperfunktionen an sich weit über die Normalwerte
hinaus schießen.
Drei
bis vier Stunden nach Beginn des Erwachsens haben
die Funktionswerte ihren Höhepunkt erreicht: bis zu 325
Herzschläge (normal
sind etwa 170 bis 200 Schläge) und eine Atemfrequenz von bis
zu 72 Atemzüge
(normal sind ca. 40 bis 50 Atemzüge) pro Minute sind zu
verzeichnen. Unter
dessen steigt die Körpertemperatur stetig an. Mit der Zeit
pendeln sich
Herzschlag und Atmung ein. Schließlich entrollt sich der Igel
ganz langsam.
15-30% ihres Körpergewichts haben die kleinen Tiere verloren,
das Stachelkleid
schlottert um ihren abgemagerten Körper.
Noch schwankend verlassen die Stachelritter ihr Winterquartier und machen sich auf den Weg, um die erste Nahrung für das neue Igel-Jahr zu suchen.
Igel im Mai
Nun sind auch die letzten
Igel aus ihrem Winterschlaf
erwacht. Je nach Witterung dauert dieser zwischen 5 und 6 Monaten. Hin
und
wieder kommt es vor, dass der ein oder andere stachelige Geselle
aufwacht.
Meistens bleiben sie im Nest und schlafen bald weiter. Es gibt wenige
Ausnahmen, bei denen die Igel das Nest verlassen und für ein
paar Tage aktiv
sind. Noch hat die Wissenschaft dieses Phänomen nicht
geklärt – man vermutet
aber, dass es sich um eine Art „Reset“ handelt, bei
welchem der extrem
heruntergefahrene Stoffwechsel für kurze Zeit wieder auf
Normalwerte gesetzt
wird.
Ist
man dann als Igel im Frühling endgültig wieder
erwacht, gilt es, die Fettspeicher wieder zu füllen
– immerhin haben die kleinen
Kerlchen bis zu 30% ihres Gewichts verloren. Wen wundert es da, dass
die
meisten Igel aussehen, als wäre ihr Stachelkleid eine Nummer
zu groß! Aber da
nun die Nahrungstiere wieder in ausreichender Zahl vorhanden sind,
haben sie
ihr verlorenes Gewicht bald wieder angefressen.
Durch die
rechtzeitige Einrichtung einer Futterstelle in dieser Zeit, kann man
den
abgemagerten Tieren einen guten Dienst erweisen. Zur Fütterung
eignen sich z.B.
Katzendosenfutter mit Igeltrockenfutter oder Haferflocken vermischt. Um
das
Futter vor Katzen und Vögeln, aber auch vor Regen zu
schützen, stellt man es
abends z.B. in ein mit mindestens zwei 10 x 10 cm kleinen
Einschlupflöchern
versehenes Kistchen.
Frisch gestärkt können sie nun dem kommenden Igeljahr entgegen blicken…
Igel im Juni
Abhängig
von Klima und Witterung liegt die Paarungszeit der Igel bei uns in
Deutschland
zwischen Ende Mai und Ende August.
Während
dieser
Zeit wandern die Igelmänner weite Strecken auf der Suche nach
Weibchen und
setzen sich dadurch vielen Gefahren (z.B. Straßenverkehr)
aus. Um ihnen die
Wanderung wenigstens im Bereich der Gärten zu erleichtern,
sollte man bei der
Umzäunung des eigenen Grundstücks darauf achten, dass
die stacheligen Gesellen
ohne Probleme von einem Garten in den anderen gelangen können.
Die Werbung nennt
man "Igelkarussell". Das Männchen umkreist während
dieser
Paarungszeremonie dabei das Weibchen oft stundenlang wieder und wieder.
Zu
beginn boxt das Igelweibchen den Bewerber mit aufgestellten
Stirnstacheln weg.
Wenn sie dann irgendwann nachgibt, erfolgt die Paarung. Danach trennen
sich die
Partner. Igel leben in keiner "Ehe". Das Männchen zieht seiner
Wege
und sucht nach anderen Weibchen. Das hat den Vorteil, dass es dadurch
für die
Igelin als Nahrungskonkurrent ausscheidet.
In
heißen Monaten
leiden auch die Igel Durst. Einen großen Dienst
können wir ihnen erweisen, wenn
wir in unseren Gärten – mögen sie auch noch
so klein sein – Wasserstellen
einrichten. Ein kleiner Teich mit flach auslaufendem (!) Uferbereich
rettet
besonders in trockenen Sommern Igel vor dem Verdursten. Flache,
standfeste
Schalen, die täglich mit frischem Wasser befüllt
werden, erfüllen diesen Zweck
aber ebenso.
Igel im Juli
Da die Aktivitäten des Igels sich im Juli nicht von denen des letzten Monats unterscheiden, werden wir hier etwas zu den „technischen Daten“ des Igels erzählen:
Erdgeschichtlich betrachtet gehören unsere Igel zu einer der ältesten Säugetierformen, die heute noch existieren. Nachgewiesen wurden sie seit dem Tertiär (70 – 2 Millionen Jahre). In all der Zeit hat sich ihr äußeres Erscheinungsbild kaum geändert.
Die Größe eines erwachsenen Igels beträgt etwa 24-28 cm. Das Gewicht liegt etwa zwischen 800 und 1500 Gramm – wie üblich ist das männliche Tier schwerer als das Weibchen.
Igelbabys kommen mit ca. 100 Stacheln auf die Welt, die während des Geburtsvorganges in die aufgequollene Rückenhaut eingebettet sind. Innerhalb weniger Stunden jedoch treten diese „Erstlingsstacheln“ aus der Haut hervor. Die zweite Stachel-Generation löst etwa im Alter von drei Wochen das weiße Stachelkleid ab und beträgt dann etwa 2000 Stacheln. Ist der Igel ausgewachsen, besitzt er die dritte Stachel-Generation mit 6000-8000 Stacheln. Selbstverständlich geht dieser „Stachelwechsel“ langsam und Schritt für Schritt von Statten, so dass ein Igel nie ohne Stachelkleid durch die Gegend ziehen muss.
Am besten ist der Geruchssinn des Igels ausgeprägt, dicht gefolgt vom Gehör – es reicht weit in den Ultraschallbereich hinein. Der Tastsinn erweist sich als relativ gut und wie bei allen nachtaktiven Tieren lässt das Sehvermögen ziemlich zu wünschen übrig.
Theoretisch könnte ein Igel ein Alter von sieben bis acht Jahren erreichen. Leider liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eher im Bereich von zwei bis vier Jahren. Die Jugendsterblichkeit ist mit einer Rate von 60-80% erschreckend hoch. Menschengemachte Gefahren erhöhen die Sterberate zusätzlich.
Natürliche Feindedes Igels sind vor allem Uhu, Dachs und Fuchs. Unter Umständen können Hunde erwachsene Igel und Katzen Igelsäuglinge bzw. Igeljunge töten. Allerdings hat es die Natur so eingerichtet, dass diese Verluste das Überleben der Art nicht gefährden – der größte Feind des Igels ist der Mensch durch die Zerstörung seines Lebensraumes.
Igel im August
In
diesem Monat werden die
meisten Igel geboren.
Bei
der Geburt wiegen Igel – abhängig
von Wurfgröße – 11 bis 25g und haben eine
Kopf-Rumpf-Länge von ca. 5,5cm. Die
Stacheln sind noch nicht zu erkennen, sie brechen erst einige Stunden
nach der
Geburt durch. Diese Primärstacheln (Stacheln der 1.
Generation) sind weiß, nach
10 Tagen etwa 1cm lang und fallen im Alter von 40-50 Tagen wieder aus.
Schrilles Pipen sind die ersten Lautäußerungen,
welche schon bald nach der
Geburt vernommen werden können.
Ab
dem 5. Tag bricht auf dem Rücken die
2. Stachelgeneration durch. Das Wachstum dieser Stacheln ist mit 20
Tagen
abgeschlossen, die Länge beträgt mit 1,1 bis 1,3cm
kaum mehr als die der
Primärstacheln. Auch sie fallen im Alter von 40-50 Tagen
wieder aus. Die
Grundlagen für die Ausbildung der
„Erwachsenen-Stacheln“ werden jetzt gelegt.
Im
Alter von 8 Tagen hat der Jungigel
ein Gewicht von 22 bis 50g erreicht. Jetzt lässt sich erstes
„Selbstbespeichel“
erkennen, die Stacheln sträuben sich und die Jungen beginnen
zu keckern.
Zwischen
dem 14 und 18 Tag öffnen sich die
Augen, die ersten Einrollversuche können beobachtet werden und
die
durchschnittliche Länge beträgt nun 6,5cm.
Ab
dem 22. Tag verlassen die Jungigel
zeitweise (tagsüber) ihr Nest, um die Umgebung zu erkunden.
Mit
dem 24. Tag beginnt der Wechsel des
Milchgebisses, die erste feste Nahrung wird aufgenommen
(hauptsächlich Regenwürmer).
Nach
vier Wochenbeträgt das Gewicht nun
etwa 200g und die Größe ca. 14,6cm.
Spätestens
in der 6 Woche ist das Ende der
Säugezeit erreicht, die Jungigel sind nun
selbstständig.
Mit
70 Tagenhaben die Jungtiere ein
Gewicht von rund 600-800g erreicht.
Igel im September
Diesen Monat sieht man immer wieder - auch tagsüber - Jungigel durchs Gelände streifen. Dies ist kein Anlass zur Sorge: ab einem Alter von etwa 24 Tagen verlassen die Tiere erstmals ihr Nest für kurze Ausflüge, sie beginnen die Umgebung zu erkunden und suchen selbst ihre erste feste Nahrung.
Das Muttertier zeigt ihnen nicht, welche Beutetiere fressbar sind. Auch sind die Kleinen bei der Jagd vollkommen auf sich selbst gestellt. Da die Jungigel zu Beginn noch nicht genug erbeuten, um ihren Hunger zu stillen, ist das Muttertier immer noch für die Kleinen da und säugt sie bis zur 6. Lebenswoche. Die Natur hat es so eingerichtet, dass mit zunehmender Beutezahl die Menge der Muttermilch abnimmt.
Von der Paarung der Elterntiere bis hin zur Selbständigkeit der Jungigel vergehen fast drei Monate. Dies ist auch der Grund, weswegen nur ein Wurf pro Jahr aufgezogen werden kann. Allenfalls bei einem Verlust des ersten Wurfes ist es möglich, dass es einen zweiten Wurf gibt.
Das Nahrungsangebot im September ist noch reichlich. So können sich sowohl die Jungigel, als auch die ausgezehrte Mutter noch ein genügend dickes Fettpolster anfressen.
Igel im Oktober
Diesen
Monat ist es so weit: die Jungigel gehen nun
ihre eigenen Wege. Nachdem das Muttertier die Jungen verlassen hat,
bleibt der
Wurf noch eine kurze Zeit zusammen. Doch schon bald trennen sich auch
die
Geschwister und suchen sich ihre eigenen Reviere.
Das
Wichtigste für die Jungigel ist nun die
Futtersuche. Instinktiv wissen sie, dass sie sich ein dickes
Fettpolster
anfressen müssen – nur so haben sie eine Chance, den
Winterschlaf zu
überstehen.
Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit bauen die Jungigel noch Sommernester – so zu sagen als Vorübung für die deutlich wichtigeren Winternester. Sommernester - zumeist ziemlich schlampig gebaut - werden oft in bereits vorhandenen Höhlungen errichtet: in Strohhaufen, unter Hecken, Kompost- oder Laubhaufen. Zum Auspolstern trägt der Igel alles in sein Nest, was er finden kann – von Blättern und Gras, über ausgerissene Pflanzenteile, bis hin zu Papier- und Plastikabfälle.
Das
Nahrungsangebot nimmt ab Mitte des Monats deutlich
ab. Besonders jetzt kann man den Igeln
(und nicht nur den Kleinen) Gutes tun, indem man eine Schale mit
Katzenfutter
rausstellt – am besten mit einem Esslöffel
Haferfocken vermengt und
Katzensicher platziert.
Auch
sollte der Garten nicht zu sauber aufgeräumt
sein, so dass der Igel noch genügend Nistmaterial findet.
Igel im November
Die Tage werden
kürzer, die Nächte länger und
kälter –
für die Igel wird es nun höchste Zeit, sich auf den
Winterschlaf vorzubereiten.
Erwachsene
Stacheltiere befinden sich bereits schon
Anfang November im Winterschlaf, die Jungigel hingegen nutzen noch jede
Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme und stöbern oft noch
nach Essbarem.
Doch
so nach und nach beginnen auch sie mit dem Bau
ihrer Winternester. Es kann passieren, dass sie zu spät mit
dem Nestbau
beginnen und nicht mehr genügen brauchbares Material finden.
Somit werden die
Nester recht unordentlich – mit ein Grund, warum viele
Jungigel in der kalten
Jahreszeit sterben.
Winternester
wirken wie wahllos aufgehäufte Blätter –
sind sie jedoch nicht. Es sind kompakte Gebilde, deren Durchmesser bei
30-60cm
liegt. So eine Nestwand kann aus bis zu 20cm dick gepacktem Laub
bestehen.
Dafür sammelt der Igel trockene (!) Blätter mit
seinem Mäulchen zum
ausgewählten Standort (oft unter Hecken, Buschwerk oder
Reisighaufen) und
schichtet sie auf. Ist der Laubberg hoch genug, so gräbt sich
der Igel hinein
und beginnt dort sich im Kreise zu drehen. Drehbewegungen im Inneren
und
elastischer Druck durch Zweige von außen bewirken, dass das
Laub flach und eng
aufeinander gepresst wird und die charakteristische Schuppenstruktur
entsteht.
Diese stabile Konstruktion schützt den Igel vor der
Nässe und Kälte des
Winters.
Sind
die Witterungsverhältnisse normal, kann man davon
ausgehen, dass etwa ab Mitte November alle Igel bis zum
nächsten März oder
April schlafen.
Igel im Dezember
Die
nahrungsarme Zeit dauert etwa von Ende Oktober bis
Ende März. Um diese „Durststrecke“ zu
überbrücken, hält der Igel seinen
Winterschlaf. Auslöser für den Schlaf sind viele
Faktoren, unter anderem der
Nahrungsmangel, der Temperaturabfall, die Abnahme der
Tageslänge, erreichen des
Mindestgewichts, Hormonspiegel-Änderungen um nur ein paar
Dinge zu nennen.
Kurz
vor Winterschlafbeginn stellt der Igel die
Nahrungsaufnahme ein. Denn schläft der Igel, kann er keinen
Kot mehr absetzen,
der Darminhalt würde faulen oder gären.
Während des Schlafs sinkt die
Körpertemperatur von ca. 35°C hinunter bis auf die
Umgebungstemperatur, fällt
jedoch niemals unter 4°C. Das Igelherz schlägt gerade
mal noch 8-9 Mal pro
Minute (im „Normalzustand“ sind es etwa 170-200
Schläge), die Atemfrequenz
sinkt von 40-50 auf 3-4 Atemzüge pro Minute. Manchmal setzt
die Atmung sogar
bis zu zwei Minuten aus.
Je
mehr die körperlichen Funktionen gedrosselt werden,
desto weniger Energie verbraucht der Igel. Die Fettreserven / der
Energielieferant kann in zwei Kategorien unterteilt werden: das
weiße Fett
dient zur Energieversorgung während des Winterschlafs, das
braune Fett wird für
den Aufwachvorgang im Frühjahr benötigt.
Würde die Körpertemperatur unter 4°C
fallen, so aktiviert der Igel das schnell energiespendende braune Fett,
„erwacht“ aus seinem Schlaf und entkommt so dem Tod
durch erfrieren. Erfolgt
dieses Unterbrechen des Winterschlafes zu oft, so fehlen dem Igel (vor
allem
schwachen oder jungen Tieren) die nötigen Energiereserven, um
im Frühjahr
aufzuwachen und das Tier „stirbt im Schlaf“.
Je
nach Witterung und somit Dauer des Winterschlafes,
verliert der Igel 15-40% seines Körpergewichts. Klar, dass die
Stacheltiere
einen „Bärenhunger“ im Frühjahr
haben!